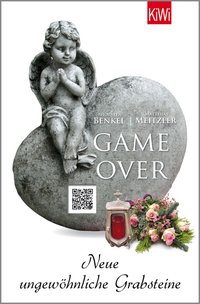|
| Ausschnitt aus dem Plan des Ohlsdorfer Friedhofes, mit Einzeichnung der erhaltens- werten Grabmale, farblich nach Zeitperioden gekennezeichnet. |
Zum Thema Denkmalschutz auf Ohsldorf habe ich schon in der Zeitschrift des Förderkreises einen längeren Beitrag geschrieben. Für die Anhörung habe ich eine Präsentation zum Thema erhaltenswerte Grabmale zusammengestellt. Auswahlkriterien für ihre Einschätzung waren im Rahmen des Forschungsprojektes der VW-Stiftung und des Denkmalschuztamtes (1981 bis 1986) ausgearbeitet worden. Aufgrund dieser Kriterien war eine Auswahl aus der fast unübersehbaren Menge der Grabmale auf diesem größten Friedhof Europas getroffen worden. Über diesen Link kann man die Präsentation herunterladen.
Der Förderkreis hat außerdem eine Liste von Kriterien zur Auswahl erhaltenswerter Grabmale aus der Zeit nach 1950 zusammengestellt. Der Grund dafür ist, dass im Forschungsprojekt der1980er Jahre bei seiner Endauswahl nur Grabmale bis 1950 berücksichtigen konnte. Jetzt werden die Grabmale aus den 1950-1980er Jahren in großer Zahl abgeräumt. Zudem hat man mit dem Projekt Ohlsdorf 2050 eine groß angelegte Diskussion über den zukünftigen Umgang mit dem Friedhof eröffnet.
Aus Sorge umd die Erhaltung der Grabmale aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg hat sich der Förderkreis - besonders ist da Frau Dr. Christine Behrens zu nennen - sehr aktiv in den Prozess der Grabmalabräumung eingeschaltet. Dieser Sorge ist es auch zu verdanken, dass sich jetzt der Kulturausschuss der Hamburger Bürgerschaft intensiv mit diesem Thema befasst. Man darf gespannt sein, wie es mit Ohlsdorf 2050 weiter geht.