Donnerstag, 11. Januar 2024
Gräber, Grüfte und Gebeine. Tod in der Frühen Neuzeit.
Samstag, 6. Januar 2024
Ausstellung "Sterblich sein" in Wien
Dazu gibt es im Netz ein ausführliches Begleitheft, in dem die ausgestellten Kunstwerke vorgestellt werden. Nur wenig bezieht sich darunter so direkt auf einen Bestattungsplatz wie die Blätter aus der Serie "Zu Besuch beim Todt – Herr Stifter läd’ ein", die Maria Bussmann (geboren 1966) 2023 geschaffen hat.
_b_451.jpg) |
| Illustration der Gartenlaube 1872 (Quelle wikimedia) |
Adalbert Stifters Text "Ein Gang durch die Katakomben" beschreibt das Netz aus Gängen und Gewölben unter dem Stephansplatz, wo bis ins 18. Jahrhundert der Friedhof der Kirche lag. Zu Stifters Zeiten lagen die Toten dort in offenen Särgen und es war schmutzig und dunkel.
Für ihre Bildserie hat die Künstlerin auch die Totenbücher aus dem Domarchiv genutzt, in denen die Namen der in den herzoglichen Grüften Begrabenen aufglistet sind. Im Begleitheft heißt es dazu: "Durch Vignetten, die an jene der Totenbücher erinnern, eröffnet Bussmann eine Sicht auf Szenen, die einer verkehrten Welt entsprungen scheinen. Hier sind etwa die Skelette höchst lebendig dabei, ihr Tagwerk zu verrichten, während die Tourist*innen wie geisterhafte Gestalten wirken. Maria Bussmann macht diesen Zwiespalt des Totengedenkens offenkundig. Zwischen Heiligkeit und Grausen liegt eine tiefe Verunsicherung, die sich als menschliche Grundkonstante erweist: Mitten im Leben ist der Tod nah." (Zu den Katakomben siehe auch die Gartenlaube von 1872)
Institutionalisierter Tod - Geschichte der Berliner Leichenhäuser
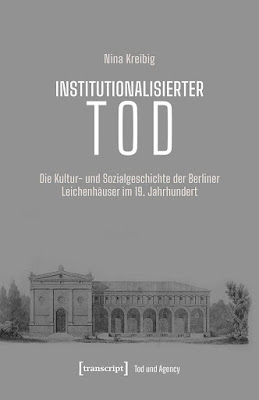 In der neuen Reihe „Tod und Agency“ ist als – zuerst erschienener – zweiter Band die überarbeitete und gekürzte Dissertation der Mitherausgeberin Nina Kreibig erschienen. In dieser Reihe soll – wie es im Vorwort heißt – ein kultur- und sozialgeschichtlicher Schwerpunkt mit interdisziplinären Ansätzen verbunden werden, „um die handelnden Personen und Institutionen in den jeweiligen Todeskontexten zu beleuchten“, daher der Titel der Reihe. Herausgeber sind außer der Autorin der bekannte österreichische Kulturwissenschaftler Thomas Macho und der Historiker Moisés Prieto, dazu stehen die Namen von einer Reihe in der Sepulkralwissenschaft bekannter Namen im Verzeichnis des wissenschaftlichen Beirats.
In der neuen Reihe „Tod und Agency“ ist als – zuerst erschienener – zweiter Band die überarbeitete und gekürzte Dissertation der Mitherausgeberin Nina Kreibig erschienen. In dieser Reihe soll – wie es im Vorwort heißt – ein kultur- und sozialgeschichtlicher Schwerpunkt mit interdisziplinären Ansätzen verbunden werden, „um die handelnden Personen und Institutionen in den jeweiligen Todeskontexten zu beleuchten“, daher der Titel der Reihe. Herausgeber sind außer der Autorin der bekannte österreichische Kulturwissenschaftler Thomas Macho und der Historiker Moisés Prieto, dazu stehen die Namen von einer Reihe in der Sepulkralwissenschaft bekannter Namen im Verzeichnis des wissenschaftlichen Beirats.
Die profunde Studie von Nina Kreibig setzt sich zum ersten Mal intensiv mit den Ideen und Ängsten, aber auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander, die in Berlin zwischen 1794 und 1871 zur Einrichtung von Leichenhäusern geführt haben. Neben einer chronologischen Entwicklungsgeschichte der einzelnen Einrichtungen, die meist kirchlichen Friedhöfen zugeordnet wurden, wird die zeitgenössische Wahrnehmung in Bezug auf diese Institutionen untersucht. Dabei steht besonders der Wandels der Bestattungskultur und der Todesvorstellungen im Vordergrund. Mit der Frage nach den Gefühlen, die für die Errichtung von Leichenhäusern bestimmend waren, und nach den Narrativen in Bezug auf Tod und Sterben wird auch die Emotionsgeschichte einbezogen. Parallel dazu wird die Stadtentwicklung Berlins thematisiert und gefragt, welchen Einfluss die Industrialisierung verbunden mit dem städtischen Bevölkerungswachstum auf die Entwicklung der Bestattungskultur und speziell der Leichenhäuser hatte. Ein weiterer Blickwinkel bezieht unter dem Stichwort „Partizipation und Agency“ die handelnden Personen und ihre gesellschaftlichen Gruppen ein und fragt danach, an wen sich die Akteure richteten und an wen nicht.
Mittwoch, 6. Dezember 2023
TAGUNGSPROGRAMM: „HISTORISCHE JÜDISCHE FRIEDHÖFE IN NIEDERSACHSEN“
 |
| Jüdischer Friedhof Hamburg - Wandsbek (Foto Leisner) |
TAGUNG „HISTORISCHE JÜDISCHE FRIEDHÖFE IN NIEDERSACHSEN“
24. Januar 2024 ▪ 9:30 – ca. 16:00 Uhr
Kulturzentrum Pavillon ▪ Lister Meile 4 ▪ 30161 Hannover
Etwa 230 jüdische Friedhöfe gibt es in Niedersachsen, von denen nur wenige noch belegt werden – der
größte
Teil sind sogenannte „verwaiste Friedhöfe“. Vielerorts sind sie die
einzigen Zeugnisse des früheren jüdischen Lebens im Ort und so bildeten
sich spätestens seit den 1980er Jahren oftmals Initiativen zu ihrem
Schutz und Erhalt. Heute sind die meisten dieser Friedhöfe Orte des
Gedenkens und der Erinnerung aber auch der engagierten
Vermittlungsarbeit, aus der im ersten Panel der Tagung verschiedene
Akteure berichten. Das zweite Panel am Nachmittag beschäftigt sich mit
dem breiten Spektrum an Gefahren, denen jüdische Friedhöfe zum Teil bis
heute ausgesetzt sind – von Vernachlässigung, bis hin zu antisemitischen
Angriffen – und dem Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit diesen
Bedrohungen. Die Tagung richtet sich an Personen, die sich beruflich
oder ehrenamtlich mit der Thematik befassen. Die Zusammenstellung des
Programms beruht auf einem „Call for Papers“ und gibt Engagierten die
Möglichkeit, ihre Forschungen und Projekte vorzustellen.
PROGRAMM
9:30 Uhr Begrüßung, Einführung in das Tagungsprogramm
PANEL 1: HISTORISCHE JÜDISCHE FRIEDHÖFE ALS AUSSERSCHULISCHE LERNORTE
- Dietrich Banse, Uelzen: Der Jüdische Friedhof Uelzen - Ort der Dokumentation und des Lernens
- Matthias Reisener und Schüler_innen der Arbeitsgemeinschaft Beth-Shalom in der Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim: Die Arbeitsgemeinschaft Beth-Shalom und der jüdische Friedhof Peiner Straße in Hildesheim
- Bernhard Gelderblom, Hameln: Der Hamelner jüdische Friedhof als Teil der Stadtgeschichte und als Lernort
- Christoph Reichardt, OStR und Stadtheimatpfleger Beverungen: Steine erzählen Geschichte(n). Der Jüdische Friedhof Beverungen als Lern- und Gedenkort
- Bodo Christiansen und Henning Bendler, Projekt „Juden in Bleckede“: Jüdischer Friedhof Bleckede - ein gewachsenes „Projekt“ ohne Masterplan und Konzept?!
- Rückfragen und Diskussion
12:15 – 13:15 Uhr Mittagspause
Freitag, 24. November 2023
Diebstahl
Wer kennt diese Figur von einem anderen Friedhof?
Diese bronzene Trauernde (aufgestellt um 1913) stand bis zum Frühjahr 2023 auf den Grabstätte Richard Lohmann dem Friedhof am Hainbuchenweg in Berlin-Frohnau. Sie wurde gestohlen. Gesucht werden jetzt nähere Informationen zu der Figur, besonders zu dem oder der Bildhauerin.
In Berlin existiert noch eine vergleichbare Statue in Stein - etwas später aufgestellt - auf der Grabstätte von Jules Brunfaut auf dem St.-Hedwig-Friedhof in der Liesenstraße.
Dienstag, 14. November 2023
Historische jüdische Friedhöfe als Orte des Lernens
 |
| Berlin, Jüdischer Friedhof an der Schönhauser Allee (Foto Leisner 2021) |
Als Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Pavillon in Hannover in Aussicht genommen. Dort soll die Tagung am Mittwoch, den 24. Januar 2024 stattfinden. Im Vorfeld wurde bis zum 6. November um Vorschläge für kurze Referate gebeten und zwar zu folgenden Themenkreisen:
- Historische jüdische Friedhöfe als außerschulische Lernorte: Vorstellung von Bildungsprojekten oder/und -materialien, von didaktischen Konzepten, von Projekten zur Bereitstellung von Informationen zur Geschichte der Orte etc.
- Antisemitismus/Prävention: Jüdische Friedhöfe in Zusammenhang mit aktuellem Antisemitismus und Antisemitismus im 20. Jahrhundert, z.B. Umnutzungen, Schändungen und insbesondere den Umgang damit
- Forschung/Gestaltung/Denkmalpflege: Laufende oder kürzlich abgeschlossene Recherche- und Forschungsprojekte, gestalterische Maßnahmen von Friedhofsanlagen und -memorialen und / oder Maßnahmen des Denkmalschutzes etc.
Regional sollten sich die Vorträge auf Niedersachsen/Bremen (oder nah angrenzend) beziehen. Im Bereich „Bildung“ sind aber auch Vorschläge aus dem gesamten Bundesgebiet willkommen, die überregionalen bemerkenswerten beispielhaften Charakter haben.
Das Tagungsprogramm ist im Post vom 6.12.2023 zu finden oder hier.
Samstag, 4. November 2023
Die Trauerhaltestelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof
Die Trauerhaltestelle – Ein Raum für Trauer, Video des Bundesverbandes deutscher Bestatter https://www.youtube.com/watch?v=766wS8s0lLQ; englische Fassung: Mourning Stop – A Space for Mourning
Seit Sommer 2021 steht auf dem Ohlsdorfer Friedhof die sogenannte Trauerhaltestelle; gedacht als Rückzugsort, an dem – obwohl öffentlich zugänglich – Menschen sich geborgen fühlen und in ihrer Trauer aktiv sein können. Zugleich sollen von diesem Ort neue Impulse für die Trauerkultur ausgehen.
Wie dieser architektonisch offen gestaltete Raum innerhalb des Friedhofs von Menschen angenommen wird, zeigt jetzt ein Kurzfilm des Videokünstlers und Filmemachers Pavel Franzusov. Darin treten Menschen auf, die hier einen Raum für ihr ganz persönliches Gedenken gefunden haben. Durch das Hinterlassen von Botschaften und kleinen Erinnerungsstücken geben sie ihrer Trauer einen persönlichen Ausdruck. Offenbar ist dieser Raum besonders geeignet für Menschen, deren Angehörige fern von ihnen verstorben und begraben worden sind, die also kein Grab in ihrer Nähe haben um sich zu erinnern und zu trauern.
Außer den Trauernden wird auch Prof. Norbert Fischer interviewt, der die Offenheit des Raumes besonders hervorhebt. Dr. Simon J. Walter, Kulturbeauftragter in der Stiftung Deutsche Bestattungskultur, weist zusätzlich auf die Freiheit hin, die es den Besuchern und Trauernden ermöglicht eigene Rituale und Trauerhandlungen zu kreieren, wobei auch der Gegensatz zu den Beschränkungen mit anklingt, die es mancherorts auf Friedhöfen noch gibt.
In der Pressemitteilung zum Film heißt es dazu: „Die Trauerhaltestelle ist ein konkreter, niedrigschwelliger Zugang zu einer neuen und individuellen Trauerkultur. Die Akzeptanz und Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen in Hamburg diesen Ort seit der Fertigstellung im Sommer 2021 im besten Sinne vereinnahmt und gestaltet haben, zeigt, wie gut das Konzept funktioniert. Die Trauerhaltestelle steht symbolisch für neue Wege und Möglichkeiten der Friedhofsgestaltung in Deutschland – und weltweit.“
Weitergehende Informationen gibt es auf diesen Seiten:
https://www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de/projekte/trauerhaltestelle-hamburg/
https://www.friedhof2030.de/trauerhaltestelle/



